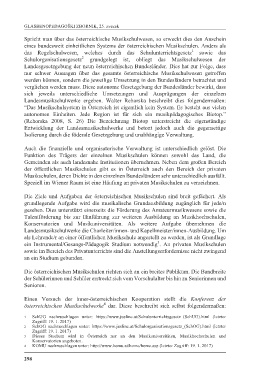Page 298 - Glasbenopedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani / The Journal of Music Education of the Academy of Music in Ljubljana, leto 12, zvezek 25 / Year 12, Issue 25, 2016
P. 298
SBENOPEDAGOŠKI ZBORNIK, 25. zvezek
Spricht man über das österreichische Musikschulwesen, so erweckt dies den Anschein
eines bundesweit einheitlichen Systems der österreichischen Musikschulen. Anders als
das Regelschulwesen, welches durch das Schulunterrichtsgesetz1 sowie das
Schulorganisationsgesetz2 grundgelegt ist, obliegt das Musikschulwesen der
Landesgesetzgebung der neun österreichischen Bundesländer. Dies hat zur Folge, dass
nur schwer Aussagen über das gesamte österreichische Musikschulwesen getroffen
werden können, sondern die jeweilige Umsetzung in den Bundesländern betrachtet und
verglichen werden muss. Diese autonome Gesetzgebung der Bundesländer bewirkt, dass
sich jeweils unterschiedliche Umsetzungen und Ausprägungen der einzelnen
Landesmusikschulwerke ergeben. Walter Rehorska beschreibt dies folgendermaßen:
“Das Musikschulsystem in Österreich ist eigentlich kein System. Es besteht aus vielen
autonomen Einheiten. Jede Region ist für sich ein musikpädagogisches Biotop.”
(Rehorska 2008, S. 26) Die Bezeichnung Biotop unterstreicht die eigenständige
Entwicklung der Landesmusikschulwerke und betont jedoch auch die gegenseitige
Isolierung durch die föderale Gesetzgebung und unabhängige Verwaltung.
Auch die finanzielle und organisatorische Verwaltung ist unterschiedlich gelöst. Die
Funktion des Trägers der einzelnen Musikschulen können sowohl das Land, die
Gemeinden als auch landesnahe Institutionen übernehmen. Neben dem großen Bereich
der öffentlichen Musikschulen gibt es in Österreich auch den Bereich der privaten
Musikschulen, deren Dichte in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich ausfällt.
Speziell im Wiener Raum ist eine Häufung an privaten Musikschulen zu verzeichnen.
Die Ziele und Aufgaben der österreichischen Musikschulen sind breit gefächert. Als
grundlegende Aufgabe wird die musikalische Grundausbildung zugänglich für jede/n
gesehen. Dies unterstützt einerseits die Förderung des Amateurmusikwesens sowie die
Talentförderung bis zur Hinführung zur weiteren Ausbildung an Musikhochschulen,
Konservatorien und Musikuniversitäten. Als weitere Aufgabe übernehmen die
Landesmusikschulwerke die Chorleiter/innen- und Kapellmeister/innen-Ausbildung. Um
als Lehrende/r an einer öffentlichen Musikschule angestellt zu werden, ist als Grundlage
ein Instrumental/Gesangs-Pädagogik Studium notwendig3. An privaten Musikschulen
sowie im Bereich des Privatunterrichts sind die Anstellungserfordernisse nicht zwingend
an ein Studium gebunden.
Die österreichischen Musikschulen richten sich an ein breites Publikum. Die Bandbreite
der Schülerinnen und Schüler erstreckt sich vom Vorschulalter bis hin zu Seniorinnen und
Senioren.
Einen Versuch der inner-österreichischen Kooperation stellt die Konferenz der
österreichischen Musikschulwerke4 dar. Diese beschreibt sich selbst folgendermaßen:
1 SchUG nachzuschlagen unter: https://www.jusline.at/Schulunterrichtsgesetz_(SchUG).html (letzter
Zugriff: 19. 1. 2017)
2 SchOG nachzuschlagen unter: https://www.jusline.at/Schulorganisationsgesetz_(SchOG).html (letzter
Zugriff: 19. 1. 2017)
3 Dieses Studium wird in Österreich nur an den Musikuniversitäten, Musikhochschulen und
Konservatorien angeboten.
4 KOMU nachzuschlagen unter: http://www.komu.at/home/home.asp (letzter Zugriff: 19. 1. 2017)
298
Spricht man über das österreichische Musikschulwesen, so erweckt dies den Anschein
eines bundesweit einheitlichen Systems der österreichischen Musikschulen. Anders als
das Regelschulwesen, welches durch das Schulunterrichtsgesetz1 sowie das
Schulorganisationsgesetz2 grundgelegt ist, obliegt das Musikschulwesen der
Landesgesetzgebung der neun österreichischen Bundesländer. Dies hat zur Folge, dass
nur schwer Aussagen über das gesamte österreichische Musikschulwesen getroffen
werden können, sondern die jeweilige Umsetzung in den Bundesländern betrachtet und
verglichen werden muss. Diese autonome Gesetzgebung der Bundesländer bewirkt, dass
sich jeweils unterschiedliche Umsetzungen und Ausprägungen der einzelnen
Landesmusikschulwerke ergeben. Walter Rehorska beschreibt dies folgendermaßen:
“Das Musikschulsystem in Österreich ist eigentlich kein System. Es besteht aus vielen
autonomen Einheiten. Jede Region ist für sich ein musikpädagogisches Biotop.”
(Rehorska 2008, S. 26) Die Bezeichnung Biotop unterstreicht die eigenständige
Entwicklung der Landesmusikschulwerke und betont jedoch auch die gegenseitige
Isolierung durch die föderale Gesetzgebung und unabhängige Verwaltung.
Auch die finanzielle und organisatorische Verwaltung ist unterschiedlich gelöst. Die
Funktion des Trägers der einzelnen Musikschulen können sowohl das Land, die
Gemeinden als auch landesnahe Institutionen übernehmen. Neben dem großen Bereich
der öffentlichen Musikschulen gibt es in Österreich auch den Bereich der privaten
Musikschulen, deren Dichte in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich ausfällt.
Speziell im Wiener Raum ist eine Häufung an privaten Musikschulen zu verzeichnen.
Die Ziele und Aufgaben der österreichischen Musikschulen sind breit gefächert. Als
grundlegende Aufgabe wird die musikalische Grundausbildung zugänglich für jede/n
gesehen. Dies unterstützt einerseits die Förderung des Amateurmusikwesens sowie die
Talentförderung bis zur Hinführung zur weiteren Ausbildung an Musikhochschulen,
Konservatorien und Musikuniversitäten. Als weitere Aufgabe übernehmen die
Landesmusikschulwerke die Chorleiter/innen- und Kapellmeister/innen-Ausbildung. Um
als Lehrende/r an einer öffentlichen Musikschule angestellt zu werden, ist als Grundlage
ein Instrumental/Gesangs-Pädagogik Studium notwendig3. An privaten Musikschulen
sowie im Bereich des Privatunterrichts sind die Anstellungserfordernisse nicht zwingend
an ein Studium gebunden.
Die österreichischen Musikschulen richten sich an ein breites Publikum. Die Bandbreite
der Schülerinnen und Schüler erstreckt sich vom Vorschulalter bis hin zu Seniorinnen und
Senioren.
Einen Versuch der inner-österreichischen Kooperation stellt die Konferenz der
österreichischen Musikschulwerke4 dar. Diese beschreibt sich selbst folgendermaßen:
1 SchUG nachzuschlagen unter: https://www.jusline.at/Schulunterrichtsgesetz_(SchUG).html (letzter
Zugriff: 19. 1. 2017)
2 SchOG nachzuschlagen unter: https://www.jusline.at/Schulorganisationsgesetz_(SchOG).html (letzter
Zugriff: 19. 1. 2017)
3 Dieses Studium wird in Österreich nur an den Musikuniversitäten, Musikhochschulen und
Konservatorien angeboten.
4 KOMU nachzuschlagen unter: http://www.komu.at/home/home.asp (letzter Zugriff: 19. 1. 2017)
298